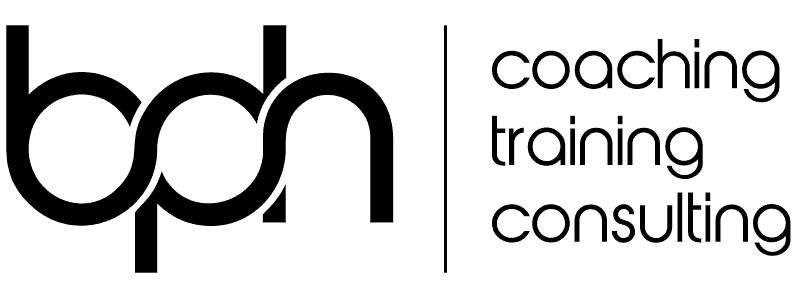Es gibt Worte, die uns kaum loslassen. „Schuld“ ist für mich eines dieser Worte. Ein kurzer Begriff, und doch liegt eine enorme Schwere in ihm. Kaum ein Konflikt, in dem er nicht auftaucht. Kaum ein Streit, in dem er nicht mitschwingt.
Sobald Schuld im Raum steht, verändert sich meist alles: Es geht nicht mehr um die eigentliche Sache, sondern um Rechtfertigung, Gegenschuld, Verteidigung, Angriff. Gefühle wie Wut, Scham oder Hilflosigkeit übernehmen das Steuer. Schuld macht groß, was vielleicht klein hätte bleiben können.
Das begegnet mir nicht nur in meiner Arbeit mit Führungskräften, Teams oder Coachees, sondern auch privat. Ein Beispiel: Wenn ich meiner Tochter zuhöre, wenn sie von Situationen in der Schule erzählt, taucht fast zuverlässig die Frage auf: „Wer war schuld?“
Doch warum hat Schuld eine so beharrliche Präsenz in unserem Denken, Fühlen und Handeln?
Warum Schuld so tief verankert ist
Sprache und Kultur haben uns geprägt. Zwei mögliche Wurzeln:
Religiöse Traditionen: Über Jahrhunderte war Schuld eng mit Sünde, Beichte und Vergebung verknüpft. Wer „schuldig“ war, musste Abbitte leisten und sich reinigen. Diese Muster wirken bis heute nach. (vgl. Künkler, Faix & Jäckel, 2020)
Geschichtliche Erfahrungen: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde „Schuld“ zum zentralen Begriff für die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Bis heute ist sie Teil der deutschen Erinnerungskultur und beeinflusst, wie wir Verantwortung und Verstrickungen begreifen. (MEMO-Studie zur Erinnerungskultur, 2025)
Diese historischen und kulturellen Spuren prägen nicht nur unser Kollektiv, sondern auch unsere Alltagssprache. „Schuld“ ist schnell zur Hand – viel schneller als Worte wie „Anteil“, „Verantwortung“ oder „Beteiligung“.
Schuld als Konfliktkleber
Schuld wirkt wie ein Kleber. Ein Konflikt, der sich eigentlich lösen ließe, wird zäh wie Kaugummi.
Denn Schuld ist selten objektiv. Sie ist meist eine Zuschreibung, ein Stempel. Sie verengt den Blick, hält uns in Opfer-, Täter- oder Retterrollen fest. Wer Schuld verteilt oder annimmt, verliert oft den Zugang zu dem, was wirklich wichtig ist: zu Anerkennung, Respekt, Zugehörigkeit. Zu dem tiefen Wunsch, gesehen und gehört zu werden.
Und doch: Schuld hat auch eine Funktion. Die systemische Forschung, etwa Klaus Eidenschink, zeigt, dass Schuldgedanken durchaus eine Rolle im sozialen Miteinander spielen können:
Sie machen Emotionen sichtbar. Schuld kanalisiert Ärger – im Team etwa, wenn Frust sich auf eine einzige Person richtet.
Sie stabilisieren Gruppen. Schuld schafft ein „Wir gegen den Schuldigen“ – wie in der Schule: „Die 3B war’s!“
Sie vereinfachen Komplexität. Statt viele Faktoren oder tieferliegende Bedürfnisse oder Dyanmiken zu betrachten, genügt ein Satz: „Du bist schuld.“ Das ist halt einfacher und komfortabler, aber leider oft zu kurz gegriffen.
Vom Schulddenken zur Verantwortungsübernahme
Das Entscheidende ist: Schuldgedanken sind kaum vermeidbar. Aber sie dürfen nicht das Ende des Gesprächs oder eines Konflikts sein. Wenn wir in Konflikten weiterkommen wollen, braucht es eine Verschiebung des Blicks. Weg von Schuld – hin zu Verantwortung.
Das bedeutet nicht, Schuld zu verdrängen oder schönzureden. Sie darf auftauchen, sie darf benannt werden. Doch sie sollte nicht dominieren. Stattdessen können kritische Fragen helfen, neue Spielräume zu eröffnen:
Was ist hier eigentlich passiert, wenn wir Schuld einmal ausklammern?
Was übernehme ich selbst – unabhängig davon, ob ich „schuld“ bin?
Wofür bin ich konkret verantwortlich?
Und: Wie gehen wir (bzw. ich) von hier aus weiter?
Ein Plädoyer für den Beziehungserhalt
Am Ende geht es nicht um eine abstrakte Debatte über Schuld. Es geht um Beziehung – im Team, in der Partnerschaft, in der Familie. Schuld kann trennen, aber Verantwortung kann verbinden. Wenn wir lernen, Konflikte nicht nur durch die Brille der Schuld zu betrachten, sondern mit der Haltung: „Was ist mein Anteil, und wie gehen wir jetzt weiter?“, dann wird ein neuer Weg sichtbar. Ein Weg, der weniger lähmt und mehr bewegt.
Für mich ist das die eigentliche Kunst im Umgang mit Konflikten: Schuld darf da sein – aber sie sollte nicht den Ton angeben. Entscheidend ist, ob wir im Konflikt steckenbleiben oder ob wir ihn nutzen, um etwas Neues zu gestalten und dadurch eine zwischenmenschliche Beziehung zum Wachsen bringen.
Neugierig geworden?
In einem persönlichen Austausch erzähle ich gerne mehr darüber. Außerdem freue ich mich über weitere Meinungen, frische Perspektiven oder Feedback zu diesem Artikel.
Teilen: